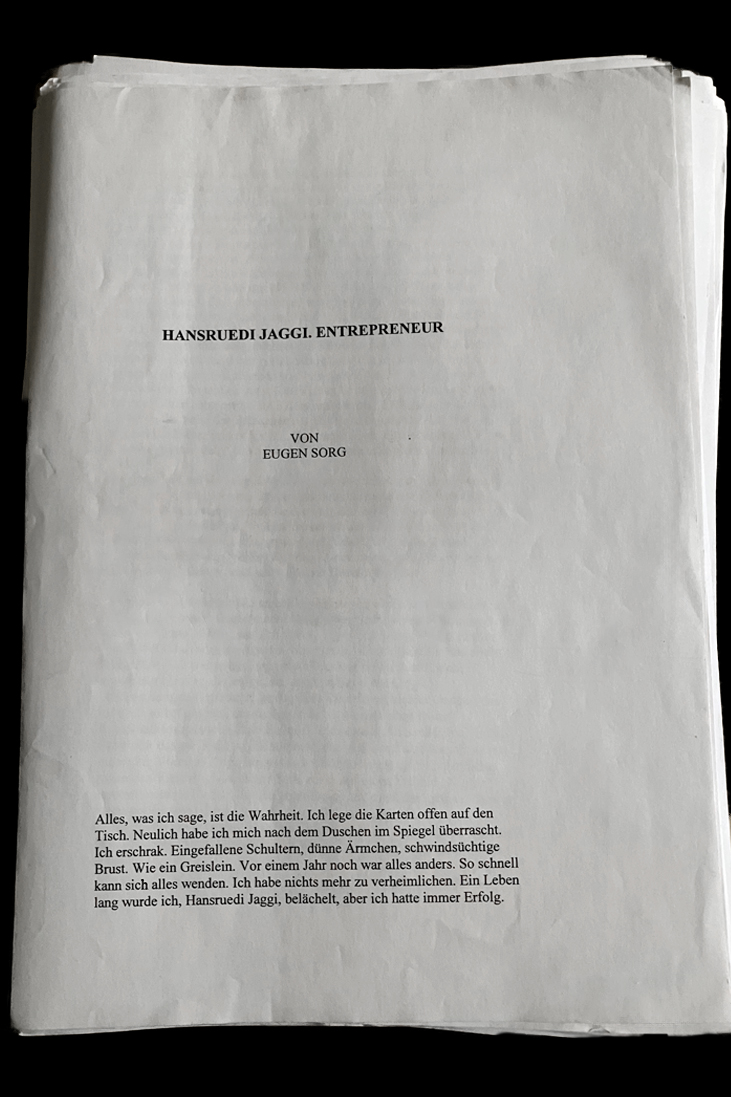
Hansruedi Jaggi
Entrepreneur
Die beklemmende Nachkriegszeit, geprägt vom Geist des Zwinglianismus, von Verzicht, strengem Arbeitsethos und Hierarchiegläubigkeit, war von einer folgenschweren Lockerung heimgesucht worden. Am sichtbarsten wurde dies in der Entwicklung einer eigenständigen westlichen Adoleszenten-Kultur. Wechselte bis anhin der Bub nach der Pubertät von der kurzen Hosen direkt in den grauen Anzug des Erwachsenen, bildete sich nun ein neuer biographischer Lebensabschnitt heraus: die Jugend. Diese genoss die Unbeschwertheit der Kindheit und dauerte bis weit ins Erwachsenenalter hinein, ohne die früher damit verbundenen Pflichten und Verantwortlichkeiten übernehmen zu müssen. Eine lange Friedenszeit und ein nie da gewesener allgemeiner Wohlstand hatten das historische Phänomen der Popkultur ermöglicht, eines jugendlichen Lifestyles mit enthemmter Musik, provozierender Mode und spezifischem Jargon.
Jugend geriet nicht nur zum Problemfall für Psychologen oder zum Studienobjekt für Soziologen, sondern auch zum hofierten Konsumenten einer hochtourig brummenden Wirtschaft. Wachstum muss wachsen, und Jugend wurde zur Kultmarke. Die Nachkriegsgeneration selber freute sich über die gestiegene Beachtung und Bedeutsamkeit, wurde frecher, lauter und selbstbewusster und stürzte sich in das Abenteuer und die frivole Freiheit einer Zeit, in der offensichtlich nichts mehr Gültigkeit hatte, alles möglich schien und alles immer besser werden würde.
Verkörperung dieses gesellschaftlichen Umbruchs war der freischweifende Geschäftsmann und Risikounternehmer Hansruedi Jaggi. Der gelernte Lampenverkäufer und Metzgersohn aus Zürich-Oberengstringen war in den späten Sechzigern- und frühen Siebzigerjahren eine der bekanntesten Figuren in der deutschsprachigen Schweiz. Der kleine,1941 geborene Mann aus dem Limmattal hatte früh gemerkt, dass die neue Rockmusik nicht nur Spass machte, sondern dass man damit auch Geld verdienen konnte. Er war selber kaum 23 Jahre alt, als er die ersten Musiktourneen mit schweizerischen und internationalen Bands organisierte. 1967 brachte er die Rolling Stones in die Schweiz, ein Jahr darauf Jimi Hendrix und weitere globale Gross-Stars. Beide Anlässe endeten mit knüppelnden Polizisten, Wasserwerfern und Steine schleudernden Jugendlichen.
Der Name des Freak-Impresarios wurde mit den Ausschreitungen in ursächliche Verbindung gebracht. Für die Behörden und den Durchschnittsbürger war er ein gefährlicher Krawallmacher, für viele Junge ein Held, der den Spiessern und den Füdlibürgern eine lange Nase machte. Jaggi versuchte keineswegs, seinen Ruf zu korrigieren. Im Gegenteil. Er trug lange Haare mit grünen Strähnen, posierte mit teurem Schmuck, spitzen Stiefelchen und sehr jungen Blondinen. Und er liess sich im samtenen Mantel im Rolls Royce vorfahren und machte aus jedem Clubbesuch einen napoleonischen Auftritt. Er war der perfekte ästhetische Hybrid aus Milieu-Archetyp und Hippie. Die Boulevardpresse hechelte hinter ihm her, und Jaggi wiederum liebte es, mit ihr zu spielen. Wenn er in der Nähe eines Blick-Journalisten über die „stieren, dummen Lohnbezüger“ spottete, wusste er, dass am nächsten Tag jeder Satz in der Zeitung stehen würde und er freute sich schon im Voraus über die Wut und Entrüstung, welche dies bei den bürgerlichen Zeitgenossen auslösen würde. Jaggi schien nicht nur Geld zu haben, obwohl er keiner feststellbaren Arbeit nachging, er protzte auch noch damit. Er war die personifizierte Negation der traditionellen Rechtschaffenheit.
Seinen grössten Coup landete er schliesslich, als er den späteren Sportler des Jahrhunderts, Cassius Clay alias Muhammad Ali, für einen Fight gegen den deutschen Schwergewichtler Jürgen Blin im Zürcher Hallenstadion verpflichten konnte. Alles hatte mit einer Bar-Prahlerei begonnen. Jaggi hatte verkündet, dass er als nächstes den „Grössten“, dass er Ali holen würde. Ein ebenfalls anwesender Blick-Reporter lachte ihn aus. Dies kränkte Jaggi, er konnte das nicht auf sich sitzen lassen. Man wettete um eine Flasche Whisky. Jetzt war es eine Frage der Ehre. Er konnte nicht mehr zurück.
Alles sprach dagegen, dass er diese Wette gewinnen könnte. Er hatte kein Geld; er sprach kein Englisch; für die schweizerischen Boxverbände war Ali ein „Grimassen schneidender Neger“ und dessen Art zu Boxen kein Sport, sondern eine grossmäulige, amerikanische Zirkus-Veranstaltung. Auch das Schweizer Fernsehen lehnte überheblich die Übertragung des Kampfes ab, und dem Zürcher Stadtrat wäre es nie in den Sinn gekommen, die Umtriebe des unverschämten Schnuderis auch noch zu unterstützen.
Dass er schiesslich am Stefanstag 1971 den Kampf Ali vs Blin im Zürcher Hallenstadion trotzdem eröffnen konnte, verdankte sich dem Geschäftsmodell des autonomen Entrepreneurs. Dieses verliess sich weniger auf einen Businessplan als auf Chuzpe, einen angeborenes Gespür für Figine, alerte Instinkte, Hartnäckigkeit, Kühnheit des Pokerprofis, Vertrauen auf Zufälle und unwahrscheinliches Glück. Alles Voraussetzungen, vor allem letzteres, die ihn auszeichneten. Den Sponsor für den Fight zum Beispiel, ein junger reicher Industrieller, wurde im allerletzten Moment von einem Freund Jaggis an einer Bartheke in Zermatt aufgetrieben. Derselbe Sponsor musste aber auch für den Verlust von fast einer Million Franken aufkommen, die der Kampf verursacht hatte. Jaggi hatte kein Geld verdient, aber auch keines verloren. Doch er hatte den Triumph. Noch nie hat er sich so sehr über eine Flasche mittelmässigen Whisky gefreut.
Nach dem Box-Spektakel im Hallenstadion diversifizierte er seine wirtschaftlichen Aktivitäten. Er führte Beizen, wo viel Jungvolk verkehrte, zuerst im Niederdorf, dann im Kreis 4, Lokale, die zum Teil legendär wurden wie das „Blow Up“ oder das „Revolution“ oder das „Stirnimaa“. Er reiste nach Ghana und wickelte dort nicht ganz legale Goldkäufe ab; in der Schweiz wiederum drehte er seinen Milieukollegen goldene Schlüsselanhänger mit den Logos ihrer bevorzugten Automarken an – Rolls Royce, Lamborghini, Ferrari; beinahe fiel er auf einen italienischen Schwindler-Erfinder herein, der ihm ein Patent für eine neuartige, tödliche Waffe andrehen wollte, für ein superstarkes Explosiv-Pulver, welches bereits im Nahen Osten erfolgreich an Schafen getestet worden sei. Und er erfreute sich am regelmässig sprudelnden Geld aus einer Beteiligung an einem Pornovertrieb. Alles in allem führte er ein gutes, ruhiges Leben, ein Gschäftli hier, ein Couvert dort, ein Zustupf da, und er war geachtet in seinen Kreisen, bis er eines frühen Morgens von der Polizei abgeholt und in Untersuchungshaft gesteckt wurde.
Man warf ihm kleinere Versicherungsbetrügereien mit angeblich gestohlenem Schmuck vor; das Untervermieten von „Zupfstuben“, von Wohnungen an Prostituierte; das Anmieten von „Zoggerlogen“, Absteigen für illegale Glückspiele. Die Staatsanwaltschaft hoffte, noch weiteren, viel grösseren Gesetzesbrüchen auf die Spur zu kommen und liess ihn über mehrere Wochen in der Einzelzelle schmoren.
In Jaggis Kreisen beurteilte man seine Vergehen als Kavaliersdelikte, als Berufsrisiko. Normale Lohnarbeit galt als ehrenrührig, der Sinn von Regeln lag darin, diese auszutricksen – ausser sie betrafen das eigene Milieu. Zum Beispiel das Gebot, nie Namen von Komplizen an die Behörden zu verraten. Jaggi ertrug die Gefangenschaft sehr schlecht. Er hörte auf zu essen, wurde trübsinnig und plauderte ein paar Namen aus. Sofort wusste dies der ganze Kreis 4. „Der Kleine singt“, erzählte man sich in jeder Bar, und er wurde verspottet und verlacht. Als Jaggi wieder entlassen wurde, merkte er schon beim ersten Rundgang durch seine Gassen im Langstrassenquartier, dass sein Ruf ruiniert war. Er hatte den Ehrenkodex verletzt, in den Blicken der Leute lag Verachtung und Spott. Man nahm ihn nicht mehr ernst. Er musste sich neu erfinden. Wie noch einige Male in seinem künftigen Leben.
Er stiess alle ihm gebliebenen Beteiligungen an Geschäften ab, verkaufte Clubs und Bars, den Rolls Royce, die Harley Davidson, die Möbel, die spezialgefertigten Stiefel, die meisten Waffen, ausser einem kostbaren Jagdgewehr, für das er einen Waffenschein hatte, und verschwand mit seiner zweiten Frau aus Zürich ohne sich noch einmal umzudrehen.
Er hatte sich in Texas eine Farm gekauft und verdiente sein Geld fortan als Berufsjäger. Schon als Kind war er durch die Büsche an der Limmat gepirscht, hatte Ratten und illegal Hechte geschossen und von einem Leben als Tigerjäger in Indien geträumt. Nun führte er gut betuchte Hobbyjäger aus Deutschland und der Schweiz durch die texanische Wildnis und lockte Bären vor deren Flinte. Er schoss selber Wild und verkaufte das Fleisch an Metzgereien.
Während den nächsten Jahren würde er dort leben, bevor er sich erneut häutete und über Zwischenstationen in Florida, Costa Rica und Amazonas zurück in der Schweiz landete. Er war wieder einmal fast mittellos, starb aber im Jahre 2000 als wohlhabender Mann an einer seltenen Nervenkrankheit. Einer der unwahrscheinlichen Jaggi-Zufälle hatte ihn mit einem reichen, alten und einsamen Unternehmer zusammen gebracht, dessen Hund er hütete und der ihm schliesslich sein Erbe vermachte. Sogar Jaggi konnte den Tod nicht überlisten, aber sein Geschäftsmodell war aufgegangen.
„Im Sommer 1997 traf ich mich während drei Wochen täglich mit Hansruedi Jaggi im Hotel Atlantis im Zürcher Triemli, dort wo einst Muhammad Ali mit seiner Entourage abgestiegen war. Er hatte mich gefragt, ob ich sein Leben aufschreiben wolle, und ich hatte zugesagt. Ich kannte ihn vom Sehen aus der Zeit, als ich als Junger seine Lokale besuchte und als er bei seinen grossen Konzerten, die ich wenn möglich ebenfalls besuchte, persönlich auf die Bühne kam. Viel später lernte ich ihn ein wenig näher kennen. Ich traf ihn wegen eines Artikels, den ich schrieb, der auch von ihm handelte, und er war mir sympathisch. Das Aufschneiderische der wilden Tage war verschwunden.
Die drei Wochen gingen schnell vorüber. Er nahm mich auf eine Reise durch eine untergegangene, aber immer noch irgendwie präsente Welt. Ein Simplicissimus der Postmoderne. Er eröffnete Einblicke in gesellschaftliche Subkulturen, die mir unbekannt waren oder die ich nur von aussen kannte. Und vor allem war er ein grossartiger Geschichtenerzähler Er wusste, wie man Spannung aufbaut, wo man die Pointe platziert und wo die Pause. Er war lustig, hatte ein Gespür für die richtige Dosis Eigenlob, Schadenfreude, Ironie und Spott. Man glaubte ihm auch die haarsträubendste Erzählung, weil sie ebenso witzig wie plausibel vorgetragen wurde. Der jahrzehntelange Umgang mit seinen Halbwelt-Kollegen war wie ein Meisterkurs in Rhetorik. Als überzeugte Gegner einer geregelten Arbeitssituation hatten sie viel Zeit für gesellige Trinkrunden. Wer die beste Story erzählte, erfuhr mehr Respekt als ein reicher Geldsack, der mit einer langweiligen daherkam. Gute Geschichten waren der Goldstandard im Milieu.
Ich hatte den Eindruck, dass Jaggi sich mit seiner Lebensgeschichte rehabilitieren wollte. Es schien ihn insgeheim immer noch zu wurmen, dass er damals vor langer Zeit, von den meisten Medien und von der Mehrheit der Leute als Glünggi und Vagant gesehen wurde. „Schaut her. Ich lege meine Karten auf den Tisch. Ich verberge nichts. So bin ich wirklich. Aus mir ist etwas Rechtes geworden und von meinen Grossveranstaltungen redet man heute noch“, wollte er mit seinen Erinnerungen mitteilen. Er meinte es ehrlich und ernst. Und er machte mich zum Beweis mit seinen Kumpanen von damals bekannt – den Freunden, ehemaligen Freunden, ärgsten Feinden. Als das Buch fertig war und ein Verlag gefunden, starb Jaggi. Er hatte sich diebisch auf das Erscheinen gefreut. Doch auch eine postmortale Freude blieb ihm verwehrt. Das Copyright lag bei der Witwe, und sie verbot kategorisch eine Veröffentlichung.“
(Eugen Sorg, 2024)
Filmbeitrag „Der Kleine“, von Emre Erham